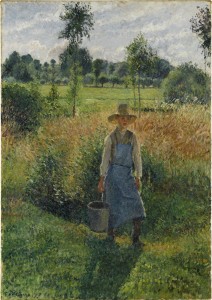Wenn heute ein Student an der Akademie eine Zeichen- oder Malklasse besucht, dann steht ihm als Ausgangsmaterial Zeichenpapier oder Leinwand zur Verfügung. In früheren Jahrhunderten hat man auch auf Holzplatten gemalt. Das alles ist nicht mehr als der Grund, auf dem das spätere Kunstwerk entstehen soll. Der Tübinger Künstler Gerhard Feuchter geht in seinen Arbeiten einen Schritt in diesem Produktionsprozess zurück. Er bemalt nicht fertiges Papier – er stellt sein Papier erst einmal her, nach Jahrhunderte alten Verfahren – und weil das Papier, das er dabei erhält, nichts mit dem zu tun hat, was man im Handel erwerben kann, sehen auch seine Arbeiten, die er aus diesen Papieren herstellt, anders aus als herkömmliche Zeichnungen.