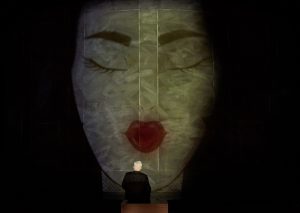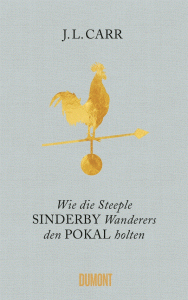Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker – die katholische Kirche nahm diese Aufforderung Christi, wie sie im Matthäusevangelium zu lesen ist, sehr genau und vor allem wörtlich. Das Ziel der Missionsarbeit war in der Tat, die ganze Welt dem Christentum zuzuführen – wenn nötig auch mit Gewalt, nicht zuletzt, weil diese Missionsarbeit nicht selten einherging mit der politischen Unterwerfung Afrikas oder Lateinamerikas durch die Kolonialstaaten. So hat die Mission, so gut sie gemeint war, nicht selten einen bitteren Beigeschmack, zumal wenn von Zwangsmission die Rede ist oder von Massentaufe. Dass es auch anders gehen kann, zeigt jetzt eine Ausstellung im Rottenburger Diözesanmuseum.