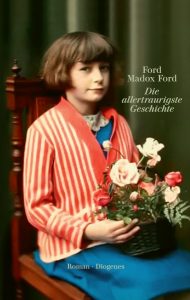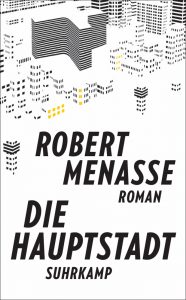Es gibt Daten, die die Welt veränderten: 1518 mit dem Thesenanschlag von Martin Luther beispielsweise oder 1789 mit der Französischen Revolution. Für die deutsche Geschichte war das Jahr 1919 impulsgebend bis in unsere Tage. Die Weimarer Republik wurde gegründet mit ihrer freiheitlichen Verfassung, die u.a. den Frauen das Wahlrecht gab, und gleichfalls in Weimar wurde das Bauhaus aus der Taufe gehoben mit einer Ästhetik, die unseren Alltag immer noch prägt. So gab der Stuttgarter Ballettintendant Tamas Detrich drei Choreographen den Auftrag, sich von diesem Jahr inspirieren zu lassen. Entstanden ist ein Aufbruch!.
Mizuki Amemiya, Diana Ionescu © Stuttgarter Ballett